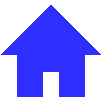Bergabenteuer
Navigation: Übersicht
DENALI - AUF DER HIMMELSLEITER DES NORDENS
Es ist knapp nach Mitternacht. Unruhig wälze ich mich in meinem Schlafsack. Habe ich schon geschlafen oder habe ich die ganze Nacht trüb vor mich dahin sinniert? Wie auch immer, in einer Stunde müssen wir raus. Zelte abbauen, Frühstück machen, essen, die Schlitten und Rucksäcke beladen, Klettergurte anlegen, anseilen, alles für Spaltensturz und –bergung vorbereiten. Es wird saukalt sein. Eben wegen dieser Kälte brechen wir so früh auf. Die schmalen Schneebrücken über die Gletscherspalten werden dann noch vereist und tragfähig sein, die beste Zeit, um ohne kräfteraubende Spaltenstürze über den flachen Kahiltna-Gletscher aufzusteigen.
Im Moment will ich noch nicht daran denken, was mich hier am Denali erwarten wird. Die Dämpfer des vergangenen Tages reichen mir völlig. Warum, um alles in der Welt, tue ich mir das an? Gibt es nicht genügend wunderschöne Gipfel, die man in drei oder vier Stunden mit leichtem Tagesrucksack besteigen kann? Nein, ich muss mir eine Dreiwochen-Tour auf einen Eisgiganten nahe dem Polarkreis aussuchen.
Jetzt gibt es kein Zurück mehr, aber scheinbar auch kein Vorwärtskommen. Alles hatte gestern so gut begonnen, doch am Schluss war ich nur groggy und deprimiert. Zeitig am Morgen haben wir das Basislager am Kahiltna-Gletscher in 2000 Metern Höhe erreicht. Frühe Morgenstunde, herrliches Wetter, wir wollen so schnell wie möglich los. Alle waren damit glücklich, doch für Dave war das ein richtiger Schock. Er hatte eine furchtbare Nacht gehabt, krank, so konnte er wohl kaum eine schwierige Bergtour starten. Aufgabe? Er war so gut wie draußen, noch ehe das Abenteuer begonnen hatte. Das wollte keiner von uns. So verteilten wir die 500 Kilogramm an Lasten auf uns sieben und nahmen Dave ohne Gepäck ans Seil. Ich fasste fürs erste 78 Kilogramm aus – genau mein Körpergewicht – vierzig Kilogramm im Rucksack, der Rest im Schlitten, der am Rucksack mit einer Reepschnur befestigt wurde.
Der Anfang war nicht übel. Hurtig ging es zweihundert Meter den Heartbreak-Hill hinunter. Warum dieser Hügel so heißt? Das versteht man erst, wenn man nach Wochen am Berg zum Basislager absteigt und dann noch mal so richtig hinauf schnaufen muss. In einer Senke, dem Zusammenfluss zweier Gletscherströme, beginnt der Berg dann wirklich. Von dort geht es nur noch nach oben, fast viereinhalb tausend Meter. Ich beginne zu leiden. Die 78 Kilo sind entschieden zu viel für mich. Ich kämpfe um jeden Meter, rette mich von Pause zu Pause. Nur ja nichts anmerken lassen! Wohltat und Erlösung, als Brien, unser Boss, endlich einen geeigneten Platz für die Nacht entdeckte. Der mühsame Lageraufbau wirkte wie ein Kindergeburtstag verglichen mit der Plackerei der letzten Stunden. Soviel zur Vorgeschichte meines Stimmungstiefs!
Der morning call mitten in der Nacht trägt auch nicht gerade zur Erheiterung bei. Aber nun muss etwas geschehen. Zum Kleinbeigeben und Umkehren fehlt mir der Mut. Na ja, dieser eine Gipfel noch und dann für immer Schluss mit solch einer Schinderei – Hügel ja, Berge nein. Mal sehen, wie dauerhaft solche Vorsätze sind!
Die Logistik des nächtlichen Lagerabbaus lässt noch zu wünschen übrig. Drei Stunden vom Weckruf bis zum Aufbruch, das muss sich wohl erst einspielen. Störende Dunkelheit? Nein, darüber können wir uns nicht beklagen. An diesem Berg wird es nie dunkel werden.
Die gute Nachricht des Tages kommt von Dave. Er fühlt sich wieder fit und will wieder voll anpacken. Gut für uns alle! Zwölf Kilogramm kann ich abgeben und, wer hätte das gedacht, mit 66 Kilo fliegt man so richtig über die hier noch recht flache Gletscherlandschaft. So ist auch bald der nächste Lagerplatz erreicht und auch dort scheint die Sonne für uns. Einige Bergsteiger rüsten gerade für den weiteren Aufstieg und lassen ihr Lager verwaist zurück. Wir können uns ins gemachte Nest setzen. Solche Glücksfälle kann man hier gar nicht hoch genug schätzen. Zeltlager am Denali sind kleine Ritterburgen, die man in stundenlanger Arbeit erstmal aus dem Eis stampfen muss. Findet man eine geeignete Stelle, kann man dort nicht einfach seine Zelte aufbauen wie am Campingplatz und sich ans Abendessen machen. Zuerst wird das gesamte zu begehende Areal Schritt für Schritt mit Lawinensonden auf mögliche verdeckte Gletscherspalten abgecheckt. Erst dann ist seilfreies Herumstreunen möglich. Jede Zeltschnur muss mittels Toter Mann-Verankerung fixiert werden und dann müssen um die Zelte Windmauern errichtet werden, so hoch wie die Zelte selbst. Mit Sägen schneiden wir riesige Eisblöcke aus dem Gletscher und bauen so unsere „Burgmauern“. Kein Wunder, dass wir glückselig in blindem Vertrauen das verwaiste Camp übernehmen. Nur das Toilettenplatzerl haben unsere Vorgänger recht spartanisch belassen. Wir rücken an, um Privatsphäre und Windschutz zu vertiefen. Doch schon bald stoßen unsere Schaufeln ins Leere, ein dunkles Loch tut sich unter uns auf. Sehr sorgfältig waren unsere Vorgänger nicht gewesen. Sie haben das Lager auf einer riesigen Gletscherspalte errichtet. Uns bleibt die Arbeit, das gesamte Terrain auf den Verlauf der Spalten unter uns abzuchecken und das Lager umzubauen. Zu früh gefreut!
Der Berg stellt sich auf, das Gelände wird steiler. Da können wir nicht so einfach mal 70 Kilo raufschleppen. Wie es weiter geht? Ganz einfach. Wir müssen alle Wege doppelt gehen.
Wir packen alles in Rucksack und Schlitten, was wir nicht unmittelbar für die nächste Nacht benötigen und schleppen es recht weit an den nächsten Lagerplatz heran. Dort graben wir ein eineinhalb Meter tiefes Loch und verstauen unsere Lasten. Wer zuwenig tief gräbt, verliert sein Futter an die Dohlen und Raben. Diese haben in den letzten Jahren enorme Fähigkeiten entwickelt, an Expeditions-Schmankerln ran zu kommen. Sogar Konservendosen bringen sie mit ihren Schnäbeln auf. Am nächsten Tag Abbau der Zelte und Aufstieg zum nächsten Lagerplatz, wo wir wieder unsere kleine Ritterburg entstehen lassen. Der dritte Tag, ein halber Rasttag, dient nur dazu, die im Schnee verborgenen Schätze ins Lager zu holen.
In diesem Rhythmus geht es Schritt für Schritt nach oben. Am achten Tag erreichen wird das Medical Camp in 4400 Metern Höhe – ein großes Wort für eine Tafel mit einer recht vage gehaltenen Wettervorschau und für zwei öffentliche Toiletten. Welch kärgliches Angebot an alpinistischer Infrastruktur! Doch gerade um diese beiden „stillen Örtchen“ kreisen die Sehnsüchte der auf- und absteigenden Bergsteigerscharen. An diesem Berg dürfen die Kletterer nichts zurücklassen, auch nicht das Allermenschlichste. Klar, das Ziel ist gut, der Weg dorthin aber steinig, oder vielmehr eisig. Die Nationalparkverwaltung ist stolz darauf, den Bergsteigern an diesem Berg nichts zu bieten als den Berg selbst, doch lumpen lässt sich diese Behörde nicht. Für zweihundert Dollar Besteigungsgebühr gibt es zwar keine Hüttengaudi, keine Toiletten und keine Sammelstellen für Abfall, dafür wird jede Gruppe mit einem kleinen grünen Kübelchen geringen Durchmessers und einer Unmenge an Plastiksäcken ausgestattet. Für das natürlichste Geschäft der Welt muss der Bergsteiger mit einem Male plötzlich ungeahnte Fähigkeiten entwickeln. Wenn er sein outdoor-untaugliches Hinterteil in den Sturm pieksender Eiskristalle hält, muss er darüber hinaus mit minutiöser Zielgenauigkeit arbeiten. Ansonsten erwarten ihn einige hoch erfreuliche Fleißaufgaben. Kein Wunder also, dass alle das sonnige Plätzchen mit den beiden Bretterverschlägen wie ihre zweite Heimat begrüßen.
Dieser Berg macht keine Geschenke, auch nicht die kleinsten. Und nochmals legt er mächtig zu. Stellenweise wird es so richtig steil, manchmal ausgesetzt. Die Mühsal nimmt nochmals zu, aber auch die Faszination. Das ist Bergsteigen wie es alle lieben. Neunhundert Meter höher wollen wir unser letztes Lager aufbauen, ehe wir zum Gipfelaufstieg rüsten. Schluss mit lustig, strenge Gewichtskontrolle ist angesagt. Vom Luxus, den wir mühevoll zum Medical Camp herauf geschleppt haben, müssen wir uns trennen. Nur das Lebensnotwendige darf nach oben, ein kärgliches Dasein wird uns dort erwarten. Und selbst das lässt sich nur mit übervoll beladenen Rucksäcken realisieren, die wir über den schmalen, ausgesetzten Grat des West Buttress balancieren. Es wird keine Zeltplane geben, unter der wir uns gemütlich zum Dinner zusammenhocken können und unsere knusprigen Hamburger mit Ketchup verfeinern. Wir werden vor Kälte bibbernd im Freien hocken und Haferschleim hinunterwürgen. Zu dritt werden wir uns in die Zweimann-Zelte quetschen.
Es ist ein Wind geschüttelter, eisiger Platz, dieses Hochlager am Denali. Meistens verziehen sich seine Besucher in die engen Zelte, wenn sie nicht gerade mit Ausbesserungsarbeiten an den von den Naturgewalten traktierten Windmauern beschäftigt sind. Hier oben angekommen, heißt es erstmals warten. Wie gerne wären wir gleich weiter aufgestiegen, endlich ganz nach oben. Solche Freundlichkeiten hat der Berg nur selten für seine Besucher bereit. Nur bei stabilem, windarmen Wetter kann man sich in die Gipfelregion wagen, doch meistens jagen eisige Stürme über das Ziel unserer Träume. Warten ist angesagt. Zwei Tage lang zerren die Böen an unseren Zelten, machen einen Höllenlärm, dass man die halbe Nacht nicht schlafen kann. Zum Glück hat Thierry Spielkarten nach oben gemogelt und so spielen wir, gut in unsere Schlafsäcke gepackt, stundenlang geistig wenig anspruchsvolle Kartenspiele, um unsere nach Sauerstoff dürstenden Hirnzellen nicht zu überfordern. Nur selten gönnt sich das Unwetter eine kurze Pause. Dann sind wir alle schnell draußen an der senkrecht abfallenden Steilwand des West Buttress und genießen das Naturschauspiel. Aus der geschlossenen Wolkendecke erheben sich faszinierende Gipfel und Eisflanken. Ganz Alaska liegt hier bereits tief unter uns, nur der von Schneefahnen verborgene Gipfel überragt uns noch.
Am dritten Tag, es ist der 18. Juni 2008, kommt endlich Bewegung in unser verschlafenes Zeltleben. Der Morgen lässt sich gut an, das Wetter scheint zu passen. Schnell würgen wir unser Frühstück hinunter und rüsten zum Aufbruch. Knapp 1000 Höhenmeter liegen vor uns, mit leichtem Gepäck. Ein Spaziergang? Zu Hause benötige ich dafür keine zwei Stunden. Doch der Denali ist anders. Allein für die ersten dreihundert Meter über die steile Traverse zum Denali-Pass benötigen wir diese Zeit und von einer erfrischenden Bergwanderung kann hier keine Rede mehr sein. Ich beginne die Zeit hochzurechnen, der Berg ist auf keinen Fall schon gegessen. Was macht den Denali so hart? Ich weiß es nicht. Das Gelände ist nicht allzu schwierig und auch die Höhe sollte mir bei der langen Akklimatisationsphase keine Schwierigkeiten machen.
Allen ist die Anspannung anzumerken, nur Dan, mein Zeltkumpan strahlt über das ganze Gesicht. Noch nie war er hier oben gewesen und doch fühlt er sich wie daheim. Jeden Felszacken weiß er zu benennen. Als er fünfzehn war, hat er seinen Großvater knapp vor dessen Tod in England besucht. Viel hat er dort über seine Ahnen erfahren. Sein Urururonkel war Missionar gewesen und der ersten Goldsucher-Welle von Texas in den Yukon gefolgt. Bald hatte sich dieser Gottesmann den harten Lebensbedingungen am Polarkreis angepasst und engagierte sich zunehmend für die durch die weißen Einwanderer bedrohten Ureinwohner. So streifte er jahrelang durch die unendliche, lebensfeindliche Weite des Yukon und Alaskas. In einem zwei Monate währenden Marsch durch die Wildnis erreichte er mit einigen Begleitern im Frühjahr 1913 die Gletscherzungen des Denali. Mit wenig Bergerfahrung, doch bestens für das Überleben in dieser kalten Wildnis gerüstet, arbeitete sich die Gruppe Meter für Meter an der Nordseite des Denali nach oben. Am 7. Juni erreichte Hudson Stuck, Dan’s Vorfahre, mit drei seiner Begleiter den Denali-Pass. Wenige Stunden später standen die vier als erste Menschen auf dem Gipfel Nordamerikas. Nie mehr hat Dan das Leben Hudson Stuck’s losgelassen. Alles hat er über ihn gelesen. Einundzwanzig Jahre später trifft Dan hier an unserem Rastplatz endlich auf die längst verwehten Fußspuren seines Urururonkels, und er wird ihnen bis ganz nach oben folgen.
Nach sechs Stunden erreichen wir eine weite, flache Senke, das Football Field. Das Ziel ist nun gut zu sehen, aber es scheint immer noch unendlich weit entfernt zu sein. Sorgenfalten bei Brien und mir! Die Windfahnen über dem Gipfel verheißen nichts Gutes, das Wetter scheint zu kippen. Nichts wie weiter, vielleicht überlegt es sich der Sturm noch einmal. Vor uns liegt der steile, 150 Meter hohe Pig Hill. Ich keuche, schnaufe und denke, dass sich diese Eisflanke keinen anderen Namen verdient hat. Endlich treten wir hinaus auf eine ebene Fläche, das Kahiltna Horn. Hier beginnt der luftige Gipfelgrat. Zu sehen ist nichts, nur zu spüren – die Entspannung auf den vermummten Gesichtern. Der Wind meint es gut mit uns und stellt seine übereifrigen Aktivitäten ein. Ein formschöner, ausgesetzter und stark überwechteter Firngrat liegt vor uns, das ist wieder Bergsteigen vom Feinsten.
Um halb fünf geht es plötzlich nicht mehr weiter, es geht ganz einfach nicht mehr höher. Eine kleine Erhebung liegt wenige Meter vor uns, das Dach von Nordamerika. Unsere zweite Seilschaft trifft wenig später ein. Totale Ausgelassenheit, wir fallen uns in die Arme, doch keiner von uns war noch wirklich ganz oben. Minutenlang starre ich auf den kleinen Grathügel zwei Meter über mir. Dort oben geht ein langes Abenteuer für mich zu Ende, ein Abenteuer, das vor knapp sieben Jahren eher zufällig im Kaukasus am Elbrus begonnen hat. Zwei Meter fehlen mir zum letzten der Seven Summits, der höchsten Gipfel der sieben Kontinente. Dann fasse ich mir ein Herz, springe in drei Sätzen hinauf auf den höchsten Punkt, kann meine ausgelassene Freude gar nicht bändigen. Ich hüpfe da oben wie ein Verrückter Pickel-schwingend herum, dass meinen Kumpels angesichts der Wechten hinter mir fast das Herz in die Hose rutscht.
Der lange Abstieg, bloßes Anhängsel und lästige Notwendigkeit nach dem Gipfelerfolg? Nicht an diesem Berg! Die Schlechtwettertage haben viele Gruppen im Hochlager zurückgehalten. Heute sind sie alle los und viele haben den Gipfel erreicht. Mit ihnen sind wir auf dem zweitägigen Weg nach unten – absolute Hochstimmung. Jeder hat seine Geschichte zu erzählen, Umarmungen, Abklatschen, feiern, auch wenn wir nur einen Flachmann für acht Leute mitgebracht haben. Keine Wehmut in unseren Reihen – wir sind heuer die einzige Gruppe, die komplett den Gipfel erreicht hat.
Die kleine Beaver setzt auf der Landebahn von Talkeetna auf, zurück in unserer Welt. Sommerwärme und Grün, danach haben wir uns nach den Wochen im Eis schon gesehnt. Wir schlendern durch das von Touristen überschwemmte Talkeetna und nützen alle kulinarischen Finessen dieses kleinen Ortes. Wir baden in der Bewunderung, die da von allen Seiten auf uns einströmt. Diese vielen Menschen sind von weither angereist, um die Nähe des großen Berges zu spüren, vielleicht sogar in einem der wenigen günstigen Augenblicke einen wolkenlosen Blick auf den Eisgiganten werfen zu können. Da oben gestanden zu haben, das ist für sie das Über-Drüber. Autogramme wollen einige und ein Foto mit den „großen“ Bergsteigern. Je länger der Abend, desto öfter werden wir zu Drinks eingeladen. Party pur, einen Tag und eine Nacht lang. Die Mühen des Denali verblassen, unsere Gespräche kreisen euphorisch um neue Gipfelziele. Und die Vorsätze nach der ersten Nacht? Unverbesserlich!
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |