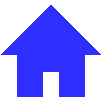Bergabenteuer
Navigation: Übersicht
IM ZAUBER DER MONDBERGE
Wie Winzlinge bewegen wir uns durch eine alles Leben beherrschende Vegetation, wir bahnen uns den Weg durch eine Pflanzenwelt, die in unseren Breiten in niedlichen Blumentöpfen so manche Wohnung ziert – Lobelien, Johanniskraut, Wiesenblumen. In der Welt aus Regen und Wolken nehmen diese Zierpflänzchen gigantische Dimensionen an. Lobelien überragen uns um sechs oder sieben Meter, Strohblumen so groß wie wir selbst. Johanniskraut, kein Kraut, das sind 15 Meter hohe Bäume, durch deren Unterholz wir uns den Weg bahnen müssen. Fast unheimlich wirkt diese riesenhafte Pflanzenwelt, undurchdringbar, unbewohnbar. Kein Tierlaut ist zu vernehmen und abseits des einzigen Pfades wird man auf keine Menschen treffen. Gedanken an Gullivers Reise ins Land der Riesen von Brobdingnag, vor fast einem halben Jahrhundert gelesen, werden wach. Das chaotische Gewirr aus Blumen und Kräutern bildet einen kaum durchdringbaren Schutzwall rund um die Geheimnisse im Zentrum dieser Berge, so als wäre diese Pflanzenpracht dazu bestimmt, die kristallene Schönheit einer hier am Äquator nie zu erwartenden Eiswelt vor allen Eindringlingen zu bewahren.
Viele Jahrhunderte, ja mehr als zwei Jahrtausende hatte es funktioniert, hat dieser abweisende und doch so faszinierende Dschungel eine ganze „Welt in der Welt“ vor den Augen menschlichen Entdeckergeistes verborgen. Im 2. Jahrhundert hat Ptolemäus von Alexandria die Quellen des Nil in den geheimnisvollen Mondbergen im Herzen des afrikanischen Kontinents angesiedelt. Ptolemäus, der Ägypten vermutlich nie verlassen hatte, machte ziemlich genaue Angaben darüber, wo sich diese Mondberge befinden sollen und heute, nach fast 2000 Jahren, wissen wir, dass er damit nicht so falsch gelegen war.
Je mehr die Welt über die Geographie Afrikas erfuhr, desto mehr war man überzeugt, Ptolemäus’ Bericht im Reich der Legende ansiedeln zu müssen. Weder die arabischen Händler noch die großen britischen Forschungsreisenden des 19. Jahrhunderts konnten irgendeinen Hinweis auf diese geheimnisvollen Quellen des Nil entdecken. Hatte er sich geirrt? Hatte er sich die ganze Sache nur ausgedacht? Hatte er vielleicht den Kilimandscharo oder den Mount Kenya gemeint und sich nur in der Lagebestimmung mächtig vertan? Doch diese beiden Berge sind so ganz anders als die von Ptolemäus beschriebenen Mondberge, zudem münden die dort entspringenden Flussläufe in den Indischen Ozean und nicht ins Mittelmeer.
1888 zieht Henry Morton Stanley mit einer riesigen Erkundungsexpedition am Fuß von lang gezogenen Abhängen vorbei, ohne auch nur zu ahnen, dass sich hinter einer nie verschwindenden Wolkenbank und einem Wall aus undurchdringbarer tropischer Vegetation geheimnisvolle Gletscher und Eisgipfel verbergen. Doch am 24. Mai dieses Jahres hat die Natur Erbarmen mit den ziellos Suchenden, der Vorhang hebt sich – für wenige Minuten. Stanley blickt aus etwa 20 Kilometern Entfernung auf unglaublich hohe Felsberge, von denen riesige Gletscher in die Tiefe stürzen, eine Eiswelt mitten am Äquator. Es ist keine Fata Morgana, auch die anderen haben diese Wunderwelt gesehen, ehe schon nach wenigen Minuten ihre Schönheiten hinter dem Wolkenschleier verschwinden. Schnell werden die dort lebenden Afrikaner befragt, sie wissen seit Menschengedenken um diese geheimnisvolle Bergwelt hinter den Wolken, auch wenn niemand von ihnen bis in ihr Zentrum vorgedrungen ist. Die legendären Mondberge des Ptolemäus, die von den Einheimischen Ruwenzori, das heißt Regenmacher, genannt werden, sind dem Dornröschenschlaf entrissen. Die Kunde von ihrer Entdeckung verbreitet sich schnell in ganz Europa. Aus allen Ecken der „zivilisierten Welt“ brechen Abenteurer und Forscher ins Innere von Afrika auf, um dieses so lange verborgen gebliebene Naturjuwel zu erschließen. Jedem von ihnen gelingt es, ein Stückchen weiter in diese Bergwelt vorzudringen als sein Vorgänger, doch die in den Himmel ragenden Gletschergipfel bleiben unerreichbar. Erst 1906 gelingt es dem Herzog der Abruzzen, Luigi Amadeo von Savoyen, dem größten Abenteurer seiner Zeit, mit einem riesigen Team von europäischen Bergführern und Forschern sowie mit Hilfe hunderter Einheimischer, die höchsten Gipfel im Zentrum dieser bizarren Bergwelt zu besteigen.
Erst vor drei Tagen sind Stefan und ich aus der weiten Ebene um den riesigen Victoria-See aufgebrochen, sind über eine unfassbar schlechte Rumpelpiste bis hinauf in das Dorf Ibanda am Fuße der Mondberge gelangt, ein endlos langes Straßendorf mit winzigen Hütten, einem farbenprächtigen Markt und einer Unzahl auf der Piste spielender Kinder, die bei der Ankunft wohl jedes Fremden in großes Gejohle ausbrechen. Die dort ansässigen Bakonjo leben vom Ackerbau, von dem, was ihnen der fruchtbare Boden abwirft, und sie leben vom Ruwenzori. Fünfhundert und mehr Touristen kommen jährlich hierher, um auf den Spuren des Herzogs der Abruzzen durch die faszinierende Dschungelwelt zu wandern und, wenn möglich, auch auf ihre höchsten Gipfel zu steigen.
Das Abenteuer hat seine Krallen verloren. Hier sind alle auf die Ankunft der Fremden vorbereitet, die anfallende Arbeit wird vom Nationalpark-Büro nach einem halbwegs gerechten Rotationsprinzip auf möglichst viele Männer des Dorfes verteilt. Ohne einheimische Begleitmannschaft darf kein Fremder in die Mondberge, das ist an allen großen Bergen Afrikas so. Manche mag dies ärgern, die darin pure Abzocke sehen. Wer allerdings tagelang mit diesen liebenswerten Bakonjo unterwegs ist, so manches aus ihrem Leben und ihrer Familie erfährt und weiß, wie viel er mit Geldbeträgen, die für uns kaum ins Gewicht fallen, im Leben dieser Menschen bewirken kann, der wird keinem Euro nachweinen. Und es wird jede Menge geboten für dieses Geld, das harte Leben der Pioniere ist Vergangenheit. In Abständen von Tagesetappen gibt es einfache Hütten, nicht zu verachten in einer Welt, die vom Regen dominiert wird. Zweimal täglich wird frisch gekocht. Die Wege sind sauber frei geschlagen. Würde man sie nicht dauernd betreuen, würden sie in der alles überwuchernden Vegetation binnen Wochen verschwinden. Geschickt sind überall Wurzeln freigelegt, an denen man sich hochziehen oder das Gleichgewicht halten kann. Die Pfade im Ruwenzori sind keine Wanderer-Autobahn, auf der man dahin schlendern kann. Es gibt kaum rhythmisches Gehen. Die Hindernisse, die die überreiche Pflanzenwelt schafft, extreme Steilstufen im Gelände, tiefer Schlamm und Flussquerungen erschweren das Vorwärtskommen und machen es doch damit um vieles faszinierender.
Die Dramaturgie des Weges zu den Eisbergen könnte besser nicht sein. Ibanda verlassen wir bei tropischer Mittagshitze auf der staubigen Fahrpiste. Bald windet sich der Pfad steil hinauf auf einen Bergrücken, mehr als 1000 Meter über dem Tal gelegen. Vorerst weist der Weg keine Tücken auf, kaum anders als ein Wanderweg in unseren Alpen. Doch Flächen riesiger Farne, Schreie meist unsichtbar bleibender Affen und das Gewirr aus Eibenwäldern und Kletterpflanzen in fast 3000 Metern Höhe erinnern uns, dass wir in eine fremde, tropische Welt eintreten.
Am nächsten Tag überqueren wir den reißenden Bujuku-Fluss, auf der anderen Seite ziehen wir uns an Wurzeln mehr als 100 Meter in die Höhe und werden, ganz plötzlich, von einer berauschenden Zauberwelt umgarnt. Die Bäume des immer dichter und dunkler werdenden Dschungels sind von ewig nassen Moosen und Flechten überzogen, die wie mystische Schleier von ihren Ästen herabhängen. Das spärliche Sonnenlicht, das durch die Wipfel dringt, wird gierig von den Wassertropfen auf den Moospölstern an den Bäumen aufgesogen und in allen Farben in den dunklen Wald reflektiert. Im Unterholz der Urwaldriesen suchen winzige Pflänzchen Schutz, die mit ihrer Blütenpracht das farbenfrohe Bild des Waldes vollkommen machen. Überall vermuten wir, dass plötzlich Kobolde, Feen und Elfen aus diesem Vegetationsschleier auftauchen und uns in eine Fantasy World entführen.
Am dritten Tag ändert sich das Landschaftsbild von neuem. Wir schreiten über weite sumpfige Ebenen und tauchen ein in eine Welt gigantischer, oft haushoher Pflanzen, eine Welt der Riesen, in der nur die Riesen fehlen. Das Dunkel senkrecht abstürzender Felswände rückt nun von beiden Seiten nahe an uns heran, das Bujuku-Tal wird enger, der Flusslauf malerisch gesäumt von Riesenlobelien und Senezien.
Immer wieder tauchen sie für Momente auf, wenn die dichte Vegetation einen Spalt freigibt, die mächtigen Kamelbuckel, die beiden höchsten Gipfel der Ruwenzori-Berge. Obwohl wir uns schon auf mehr als 3500 Metern Höhe befinden, ragen sie unheimlich hoch und schroff in den Himmel. Wir genießen das hier so seltene Glück eines wolkenlosen Morgens. Die immer noch große Entfernung lässt die Gipfel unbezwingbar steil erscheinen, es sieht aus, als würden die Gletscher dort senkrecht in die Tiefe abstürzen. Augenblicke später verschwindet die unwirkliche Kulisse steil aufragender Gletscherberge in einem Meer aus Vegetation. Wir erklettern eine der vielen Steilstufen über ein Gewirr frei hängender Wurzeln und stehen vor einem malerischen See in fast 4000 Metern Höhe. Wolkenfetzen huschen über das spiegelglatte Wasser, hüllen die Landschaft in ein mystisches Dunkel und mahnen uns, unsere Schritte zu beschleunigen – der nachmittägliche Regenguss kündigt sich an. Bis zum nächsten Morgen wird es gießen, wie kann es anders sein im Land des Regenmachers. Trockenzeit – Regenzeit – diese Begriffe haben hier ganz andere Wertigkeiten als im Rest der Welt, sagen nur etwas über die Dauer der sich fast täglich öffnenden Himmelsschleusen aus.
Wir verschwinden schnell im Schutz der Bujuku-Hütte. Zufrieden blicken wir von der kleinen, überdachten Terrasse auf die herabstürzende Wasserwand, die sich vom Dach ergießt – gerade noch geschafft! Es wird eisig. 4000 Meter Höhe sind auch am Äquator, besonders bei diesem Wetter, ein kalter, lebensfeindlicher Ort.
Am nächsten Morgen bereitet uns der anhaltende Regen Sorgen für den weiteren Anstieg. Doch die „Trockenzeit“ lässt uns nicht im Stich. Bald klart es auf und der schon übliche regenfreie Vormittag ermöglicht uns einen problemlosen Aufstieg zur Elena-Hütte.
Unheimlich steil geht es hinauf in die Felsregionen, unbezwingbar sieht das Ganze aus. Doch die Bakonjo haben hier einen leicht begehbaren Pfad in die fast vertikalen Wände gelegt, einen Pfad, auf den der Herzog der Abruzzen noch nicht zurückgreifen konnte. Die Pflanzenwelt verliert das gigantisch Riesenhafte, mit jedem Höhenmeter werden Lobelien und Senezien immer kleiner. Sie kämpfen hart ums Überleben im steilen und kalten Gelände. Die Gipfel, meist in Wolken, lassen nur spärlich Sonnenlicht an ihren Flanken zu, die Landschaft ist in dauerhaftes Dämmerlicht gehüllt. In 4400 Metern Höhe endet die Vegetation abrupt, wir betreten eine stille, leblose Einöde. Kahle, dunkle Felsen, rund geschliffen, kein Pflänzchen in den zahlreichen Rinnen und Ritzen, nicht einmal Vögel verirren sich hier herauf – das geheimnisvolle, fremd wirkende Zentrum einer kleinen Welt, die rundum von einer auf dieser Welt einzigartigen Vegetation dominiert wird. Noch vor wenigen Jahrzehnten war diese düstere Felslandschaft von einer bezaubernden Gletscherwelt bedeckt gewesen, der glaziale Schwund ist entlang des Äquators noch stärker als in anderen Teilen der Erde zu bemerken.
Wir erreichen die Elena-Hütte in 4500 Metern Höhe, ein Wind geschütteltes, kaltes und lausiges Plätzchen, nicht mehr als ein Dach über dem Kopf. Noch sind wir zu fünft, die beiden südafrikanischen Triathleten, Peter, der unterhaltsame Deutsche, der so viel über Land und Leute zu berichten weiß und eben Stefan und ich. Die Hütte bietet gerade einmal genug Platz, unsere Schlafsäcke am Boden auszubreiten und daneben an einem winzigen Tisch zu essen. Unsere einheimischen Begleiter ziehen sich in einen noch lausigeren Unterschlupf zurück. Dauerregen, Kälte, nur wenige Meter Sicht in den Nebelbänken – all das lässt die Lebensgeister erlahmen. Der Weg zum Toiletten-Häuschen hat Charakter, eine Kletterei im oberen I. Schwierigkeitsgrad. Die nächtliche Notdurft wird von Abenteuer-Flair begleitet.
Um halbsieben brechen wir im Schein der Stirnlampen auf. War die Elena-Hütte einst am Rand des Gletschers errichtet worden, so müssen wir nun fast eine Stunde durch die steilen Felsen klettern, ehe wir die weiße Welt des Alexandra-Gletschers betreten. Die Gletscherströme sind nicht mehr wie früher miteinander verbunden. Alles ist hier zerrissen. So müssen wir auf vom Eis glatt geschliffene, steile Felsen ausweichen und im II. Schwierigkeitsgrad klettern, ehe wir die Zunge des Margherita-Gletschers erreichen, der direkt zum Sattel zwischen den beiden Hauptgipfeln hinaufführt. Links von unserer Route hängt eine Stahlleiter bizarr in den senkrechten Felsen, unerreichbar. Noch vor sechs Jahren war einer unserer Freunde auf diesem Weg unterwegs gewesen und er war von der Stahlleiter direkt auf den Gletscher gestiegen. Nun fehlen vier bis fünf Meter, um die Leiter zu erreichen. Nirgends auf der Welt war mir die Erderwärmung so bewusst geworden.
Der Margherita-Gletscher, der aus der Entfernung so unbezwingbar steil ausgesehen hatte, legt sich weit zurück, ist leicht zu begehen. Trotz der zahlreichen Niederschläge findet sich keine Spur von Neuschnee. Alles ist weggeblasen. Dem Gletscher fehlt jede Gleichförmigkeit, die Eisfläche ist vom Wind aufgeworfen und von Tausenden kleiner, etwa 40 Zentimeter aufragender Eiszacken bedeckt. Als wir den Sattel zwischen den beiden Hauptgipfeln erreichen, klettern wir entlang unglaublich faszinierender Eisformationen, Kunstgebilde geschaffen aus Schnee und Wind. Über eine etwa zehn Meter hohe Felsplatte erreichen wir im III. Schwierigkeitsgrad den Gipfelgrat. Zwanzig Minuten leichter Kletterei führen uns hinauf auf den höchsten Punkt des Ruwenzori, den 5109 Meter hohen Margherita-Peak, zugleich der höchste Gipfel Ugandas.
Doch was ist das? Hinter dem Gipfel fällt der schmale Grat leicht ab in einen Sattel, steigt wieder an und bildet einen zweiten Gipfel, der exakt die gleiche Höhe wie der Margherita-Peak besitzen dürfte. Wir folgen dem Grat, überqueren die unsichtbare Staatsgrenze und stehen Minuten später auf dem Ngaliema, dem höchsten Gipfel der Demokratischen Republik Kongo.
Beim Abstieg wird die Elena-Hütte zur bloßen Zwischenstation. Sie könnte nicht uns fünf und die sechs Neuankömmlinge beherbergen. So ziehen wir weiter, kehren zurück in die Zauberwälder am Fuße der Mondberge, doch nicht auf dem Weg, auf dem wir gekommen sind. Wir wählen das parallel zum Bujuku verlaufende Mobuku-Tal für unsere Rückkehr in die bewohnte Welt.
Die beiden Kitandara-Seen liegen malerisch eingebettet in Wäldern aus Senezien. Die Hütte, direkt am Wasser gelegen, schafft einen der idyllischsten Rastplätze, die auf dieser Welt vorstellbar sind.
Noch einmal geht es steil hinauf zum 4350 Meter hohen Freshfield-Pass, wo uns mehrere hundert Meter hohe, senkrechte Abstürze, überwuchert von glitschig-nasser Vegetation den Weiterweg versperren. Abbruch? Nicht bei den Bakonjo! Sie haben in mühevoller Kleinarbeit einen wunderbaren Weg in diese Steilwände gelegt, unzählige frei gelegte Wurzeln schaffen einen Klettersteig, der nicht aus Eisen, der nur aus Natur besteht.
Am siebten Tag steigen wir auf unter 3000 Meter Höhe ab. Die Welt aus gigantischen Riesenpflanzen ist verschwunden, ein mächtiger Wald aus 30 Meter hohem Bambus bildet den Ausgang zurück in die reale Welt. Bald schließt sich der Kreis. Wir treffen in der Nyabitaba-Hütte ein, die unser Nachtlager nach dem ersten Aufstiegstag bildete. Den folgenden Weg hinunter nach Ibanda kennen wir bereits.
Gedankenverloren steige ich den Pfad ab, während dicke Regenwolken den Himmel verdunkeln. Mir kommen die Erzählungen von Robert Louis Stevenson, Jonathan Swift und Jules Verne in den Sinn. Sie alle berichten von geheimnisvollen Inseln, in deren Zentren mystische Zauberwelten zu finden sind und die nur deshalb nie entdeckt werden konnten, weil schroffe Küstenklippen und ständig kreisende Wolkenwände die magische Welt im Innern vor allen Augen verborgen haben. Ich blicke zurück auf die so gewöhnlich wirkenden Vorberge des Ruwenzori und auf die immer enger zusammenrückenden Wolkenbänke. Nie würde ich dahinter die zauberhafte Wirklichkeit der Mondberge vermuten.
Bericht: Geri Winkler, Fotos: Stefan Peer (16:9) und Geri Winkler (4:3)
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
.jpg) |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
.jpg) |
.jpg) |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |